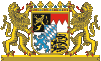Hightech soll Förstern und Waldbesitzern helfen
Mit Drohnenunterstützung zum klimafitten Wald
Mitte November bot sich im „Allmannshorn“ westlich von Babenhausen ein ungewöhnliches Bild: Auf dem höchsten Punkt im Wald stand ein 37 Meter hoher Kran. Von seiner Arbeitsbühne aus starteten Förster der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) sowie des AELF Krumbach-Mindelheim ein gemeinsames Modellvorhaben zur Digitalisierung der Waldbewirtschaftung.
Aus der Not geboren
Im Juli 2023 traf der Sturm Ronson das Allmannshorn, einen etwa 400 ha großen fichtendominierten Privatwaldkomplex, mit voller Wucht. Später ebneten Nassschnee und weitere Winde dem Buchdrucker den Weg. Die Folgen sind große Schadflächen mit ebenso großflächiger standörtlich ungeeigneter Fichtennaturverjüngung sowie pflegedringliche Jungbestände. Die Försterinnen und Förster des AELF versuchen, durch Beratung und Förderung möglichst viele Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen zu motivieren, die Flächen klimaresistent aufzuforsten und fichtendominierte Bestände zu pflegen – doch erreichen längst nicht alle. So entstand die Idee zur Zusammenarbeit mit der LWF. Die Wissenschaftler nutzen bereits die Vorteile von spezialisierten Drohnen, um schwer zugängliche Schutzwälder in den Alpen zu erkunden.
KI-Unterstützung
Schon jetzt sind Luftbilder für die Beratung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer unerlässlich. Doch was die hochauflösenden Drohnenbilder leisten, können diese herkömmlichen nicht oder nicht im gewünschten Umfang. Letztere haben eine zu geringe Auflösung, um die gewünschten Details zu erkennen. Zudem sind sie unter Umständen mehrere Jahre alt – während die Drohnen-Bilder tagesaktuell sind, also auch die aktuelle Situation vor Ort abbilden.
Das erhoffen sich die Beteiligten:
- Pflege- und Pflanzbedarf ermitteln: wo sind Kahlflächen zur Pflanzung, wo niedrige Dickungen oder höhere Althölzer?
- Auf den Freiflächen hilft die digitale Verknüpfung von Luftbildern und Standortsdaten, eine individuelle Empfehlung zur Wiederaufforstung zu geben.
- Mischungselemente erkennen, wie einzeln in Dickungen eingestreute Laubbäume. Diese Mischungselemente können die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer dann gezielt pflegen. Je nach Voraussetzung gibt es dafür auch Fördergelder.
- Das hochauflösende Höhenmodell des Waldgebietes hilft den Fachleuten, Pflegebereiche, z. B. Dickungen, auszumachen oder Althölzer, die sich bereits für eine Verjüngung eignen.
- Vorteile für die Erschließungsplanung, denn fehlende oder mangelhafte Erschließung erschwert den Waldumbau erheblich.
„Der Einsatz von Drohnen und hochauflösenden Auswertungsprodukten am Allmannshorn ist für uns eine große Chance. Es hilft der Wissenschaft, neue Einsatzgebiete für die drohnengestützte Fernerkundung zu identifizieren und die Ergebnisse daraus auf ganz Bayern umzulegen. Für uns am AELF ist es wichtig, die Wiederbewaldung und den Waldumbau am Allmannshorn und im Amtsgebiet voranzubringen. Dabei unterstützen uns die digitalen Luftbilder und die Auswertungen der Kollegen an der LWF enorm – die gewonnenen Erkenntnisse kommen letztlich den einzelnen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern zugute.“ (Abteilungsleiter Dr. Stefan Friedrich)